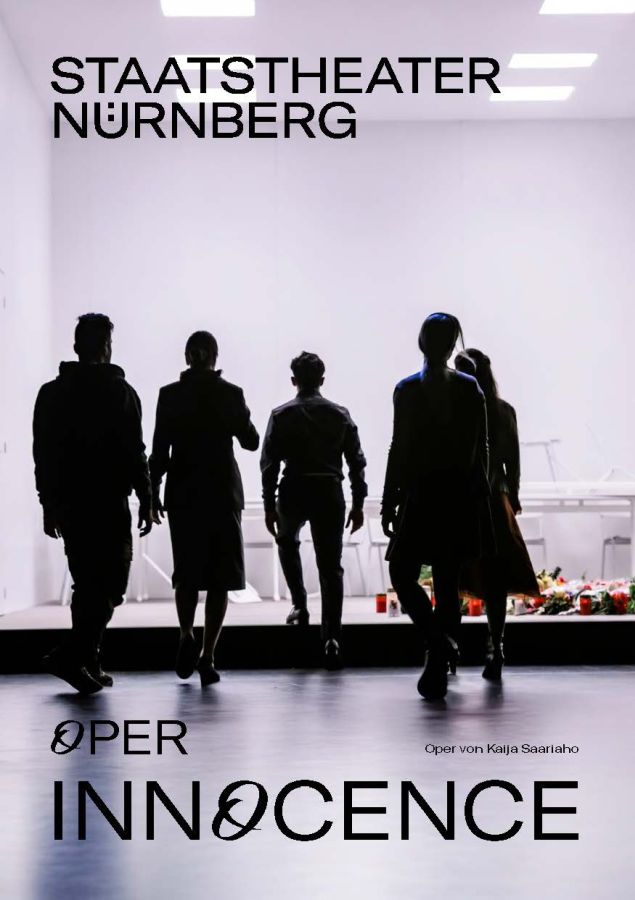- Innocence
- Staatstheater Nürnberg
- Oper von Kaija Saariaho, Saison 2025/26
- S. 23-30
Opfer und Täter
Text: Georg Holzer
In: Innocence, Oper von Kaija Saariaho, Saison 2025/26, Staatstheater Nürnberg, S. 23-30 [Programmheft]
Der Amoklauf ist zu einem Verbrechen unserer Zeit geworden. Auch wenn der Begriff aus dem ostasiatischen Raum stammt und amok-ähnliche Taten schon seit Jahrhunderten bekannt sind, sind Amokläufe in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem eine Geißel des Westens. Die meisten solcher Ereignisse haben in den letzten Jahrzehnten in den USA und Europa stattgefunden. Diese scheinbar willkürlichen Gewaltausbrüche in Friedenszeiten lösen Entsetzen und Angst aus, egal, aus welchen Motiven sie entstanden sind. Die Forschung unterscheidet zwischen politisch-religiösen Massenmorden wie auf Utøya oder dem Berliner Breitscheidplatz, rassistischen Anschlägen wie in Hanau oder am Münchner Olympia-Einkaufszentrum und Amokläufen, die ein primär persönliches Motiv haben. Zu ihnen gehören vor allem die Amokläufe an Schulen, die zwar statistisch gesehen zum Glück sehr selten vorkommen, aber große öffentliche Aufmerksamkeit erregen und deshalb den Fachbegriff „School Shooting“ hervorgebracht haben.
Sie bestürzen uns deshalb so sehr, weil die Täter – es sind fast immer junge Männer – in einen geschützten Raum eindringen, dem wir unsere Kinder anvertrauen, und weil es sich sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern um Menschen handelt, die gerade erst ihre ersten Schritte ins Leben machen. Deshalb wollen wir, wenn eine solche Tragödie passiert, möglichst viel darüber wissen: Wie ist es dazu gekommen? Was für eine Sorte Mensch sind die Täter? Wie kann man ihre Gefährlichkeit schon vor der Tat erkennen und sie dadurch verhindern? Doch gerade auf die Berichterstattung über sie selbst und ihre Tat haben es die Amokläufer abgesehen. Deshalb hat eben diese Berichterstattung Nachahmer oft zu weiteren Taten inspiriert. Vielleicht findet gerade die antirealistische Kunstform Oper einen Weg, ein so unfassbares Verbrechen wie ein „Highschool Shooting“, seine Ursachen und seine Folgen zu untersuchen. Das ist die Idee hinter der Oper „Innocence“ von Kaija Saariaho, Sofi Oksanen und Aleksi Barrière. Eine kühne Idee, denn sie birgt die Gefahr, nicht nur mit den Opfern zu leiden, sondern auch Verständnis für den Täter zu empfinden, der so viele Leben ausgelöscht oder irreparabel beschädigt hat. Aber es ist ein Versuch, mit künstlerischen Mitteln über die Phrase der „thoughts and prayers“ hinauszukommen, die zum Symbol der öffentlichen Hilflosigkeit angesichts solcher Verbrechen geworden ist. Ein Versuch, dieser Hilflosigkeit, der Trauer und der Wut eine Stimme zu geben.
Ein Täter ohne Gesicht
Deshalb bekommt der Amokschütze in „Innocence“ keine Gestalt. Es gibt eine klare Anweisung der Autorinnen, ihn nicht auf der Bühne zu zeigen. Er bekommt nicht einmal einen Namen, ist für die Familie nur der Bruder und der „Erstgeborene“, für die gehässigen Mitschülerinnen der „Frog Boy“. Gesichter und Stimmen bekommen die anderen, die Opfer. Die „students“, also die überlebenden Schülerinnen und Schüler, erinnern sich zehn Jahre danach an die Katastrophe. Noch immer sind sie nicht in einem normalen Leben angekommen. Sie haben Ticks, die direkt mit dem Geschehen in Verbindung stehen, kriechen nachts in Schränke oder unter Betten, können Menschenmengen nicht ertragen, nicht mit dem Rücken zu Türen sitzen, keine frische Farbe riechen, weil mit ihr damals die Blutflecken in der Schule übermalt worden sind. Die Bilder der Tat haben sich tief in ihr Gedächtnis gegraben. Sie sind wütend auf eine Gesellschaft, die für kurze Zeit Solidarität und Entschlossenheit zeigte, um dann zur Tagesordnung zurückzukehren. Für alle anderen ging das Leben weiter, doch die Überlebenden bleiben gezeichnet. Dazu kommen bei manchen von ihnen Schuldgefühle wegen ihres Verhaltens während des Amoklaufs. Lilly hat sich in einem Schrank versteckt und ihr Versteck nicht für flüchtende Mitschülerinnen geöffnet. Jerónimo ist weggelaufen, ohne sich um die anderen zu kümmern. Sie haben einen Preis für ihr Überleben bezahlt.
Das Unschuldslamm
Auch die Familie des Täters fühlt sich als Opfer. Nach der Tat hat ihr Umfeld sie als Aussätzige behandelt. Sie haben alle Freunde verloren, bis auf den alten Pfarrer, der ihnen aus christlicher Nächstenliebe die Treue hält. Sie können noch immer nicht fassen, dass dieses Unglück gerade über ihre vermeintlich heile Familie gekommen ist. Immerhin Vater Henrik räumt ein, dass er seinen sensiblen Sohn zum echten Mann erziehen wollte, auch indem er ihn mit Jagdwaffen vertraut gemacht hat. Auch Mutter Patricia denkt darüber nach, was sie falsch gemacht haben könnte, endet allerdings immer wieder im Selbstmitleid. Am liebsten würde sie ihren Mutterinstinkten freien Lauf lassen und den älteren Sohn, der gerade aus der Haft entlassen wurde, wieder in die Familie aufnehmen. Die Hochzeit des jüngeren Sohnes ist nach zehn Jahren der erste Hoffnungsschimmer. Mit der Braut Stela kommt eine mögliche Erlöserin in die Familie. Sie stammt aus einem fernen, armen Land, weiß nichts von der Tragödie und der Verstrickung der Familie. Für sie ist das Leben in Finnland ein Versprechen von Sicherheit und Wohlstand, in der Familie glaubt sie Liebe und Geborgenheit zu finden. Sie wundert sich nicht über die winzige Hochzeitsgesellschaft und genießt ungetrübt die Zuneigung, die man ihr entgegenbringt. Es ist bezeichnend, dass im Personenverzeichnis der Oper Henrik und Patricia als „Schwiegervater“ und „Schwiegermutter“ betitelt werden: Die Zentralperspektive liegt bei Stela. Sie ist die Haupt- und Titelfigur der Oper, denn sie ist die Einzige, die tatsächlich unschuldig ist. Alle anderen, so stellt sich nach und nach heraus, haben ihren Anteil am Weg zur Katastrophe.
Wer ist schuld?
Ein klassischer Krimi ist „Innocence“ nicht, denn der Mörder steht von Anfang an fest. Doch die Suche nach dem Täter wird ersetzt durch die Suche nach der Schuld. Die liegt offensichtlich beim Schützen, der alleine gehandelt hat. Aber hat er das wirklich? Nach und nach schälen sich Verantwortlichkeiten und Fehler heraus. Jede und jeder ist Opfer und Täter zugleich. Der Vater ist nicht angemessen auf seinen Sohn eingegangen und hat die Waffen nicht sorgfältig genug verwahrt. Der Pfarrer hat gesehen, wie der Junge mitleidlos ein Tier misshandelt und sich an seinem Leiden gefreut hat, und hat daraus keine Konsequenz gezogen. Die Mitschülerinnen haben den späteren Täter verhöhnt, die Mitschüler ihn gedemütigt und erniedrigende Videos von ihm ins Netz gestellt.
Aber es kommt noch ärger. Denn der Täter hat keineswegs allein gehandelt. Er hatte Mitwisser, die die Tat mit ihm geplant haben und sie deshalb auch leicht hätten verhindern können. Die eine ist seine Klassenkameradin Iris. Sie hat sich mit dem späteren Schützen angefreundet, weil sie mit ihm die Arroganz gegenüber den Mitschülern und den Spaß an Gewalt teilte. Ihr Motiv, sich an der Tat zu beteiligen, ist klar: Sie will, dass ihr Stiefvater stirbt, ein Chemielehrer an ihrer Schule, der sie sexuell missbraucht. Aber ihre Faszination für die Tat und den Täter geht über diese konkrete Absicht hinaus. Iris wird zum Sprachrohr des Täters, der in der Oper stumm bleibt. Sie teilt mit ihm das aus Demütigungen geborene Überlegenheitsgefühl und die Allmachtsfantasien, die im Massaker gipfeln. Vor der Tat verlässt sie ihn (aus einem Grund, der wie vorgeschoben wirkt), aber ihre Bewunderung für ihn und ihre Verachtung für die anderen bleibt ungebrochen.
Ebenso die Tat überdauert hat Tuomas’ Liebe zu seinem großen Bruder. Auch er war an der Planung des Amoklaufs beteiligt und sollte auf die Flüchtenden schießen, ist aber aus Angst selbst geflohen und hat dann eilig versucht, seine Spuren zu verwischen. Wie Iris hätte er die Tragödie also mühelos verhindern können. Nun, am Tag seiner Hochzeit, gesteht er seinen Anteil am Massaker. Den Kontakt zum Bruder hat er während dessen Zeit im Gefängnis nicht abgebrochen. Auch dieses Geständnis muss Stela ertragen und damit fertigwerden, dass sie, die Unschuld, in ein dichtes, unentwirrbares Geflecht von Schuld eingeheiratet hat.
Im Totenreich
Die tragischste unter all den beschädigten Figuren des Stücks ist Tereza. Sie hat beim Amoklauf ihre Tochter Markéta und damit alle Lebensfreude verloren. Sie kann nur weiterleben, indem sie die Erinnerung an Markéta tagtäglich am Leben erhält: Sie kauft ihr Äpfel, fährt jede Woche um die gleiche Zeit zum Klavierunterricht und wartet die Stunde im Auto ab, versprüht Markétas Parfum in der Wohnung. Verbittert stellt sie fest, dass die Welt ihre Tochter zu vergessen beginnt, und bewahrt sie umso verbissener in ihren Gedanken. Obwohl die Oper realistisch erzählt ist, darf Markéta als Tote auf der Bühne weiterleben, als Fantasie ihrer Mutter, die ihre Tochter nicht gehen lassen kann. Kaija Saariaho hat Markéta jedoch musikalisch deutlich von den anderen Figuren abgesetzt, indem sie eine „Folk-Sängerin“ verlangt, also ausdrücklich keine Opernstimme: Markéta kommt hörbar aus einer anderen Welt.
Dass Tereza nun bei der Hochzeitsfeier als Bedienung gerade auf die Familie des Attentäters trifft, die im Begriff ist, einen neuen Anfang zu machen, ist für sie eine Katastrophe. Sie will sich am vermeintlichen Glück der anderen rächen, indem sie der ahnungslosen Stela vom abwesenden Bruder des Bräutigams erzählt, den man ihr sorgsam verschwiegen hatte. Damit bringt sie das Gebäude aus Verdrängung und Schweigen zum Einsturz, was zum Eklat führt, aber auch neue Wege eröffnet, nicht nur für die Familie, sondern auch für Tereza selbst. Sie ist gezwungen, sich mit dem Anteil ihrer Tochter an der Tragödie auseinanderzusetzen und ihre Trauer, Einsamkeit und Bitterkeit loszulassen.
Klangwelten, düster und hell
„Innocence“, Kaija Saariahos letzte Oper, ist zwischen 2012 und 2019 entstanden und wurde im Juni 2021 beim Festival in Aix-en-Provence uraufgeführt. Der Dramaturg Aleksi Barrière hat den Entstehungsprozess des Stücks detailliert festgehalten. Nach dem Auftrag des Royal Opera House London für eine neue Oper ließ sich die Komponistin zunächst von Leonardo da Vincis „Abendmahl“ inspirieren. Davon geblieben ist in „Innocence“ die Zahl der Figuren, dreizehn, und die Idee, dass der Schuldige – also der Verräter Judas – in die Runde integriert und nicht sofort als Übeltäter erkennbar ist. Zum ersten Mal im Opernschaffen von Saariaho war Handlung in der Gegenwart verwurzelt. Das Libretto der finnischen Schriftstellerin Sofi Oksanen wurde von Barrière in die verschiedenen Sprachen der Figuren übertragen; diese Vielsprachigkeit des Textes bezeichnet er als zentrales Anliegen des Stücks. Die Musik der Oper ist vielleicht etwas weniger experimentell angelegt als in Saariahos früheren Werken, doch bleibt die Komponistin ihrem Grundsatz treu, mehr nach Klängen und Atmosphären als nach Melodien und harmonischen Verbindungen zu suchen. Ohne auf spektakuläre Effekte aus zu sein, steht die Musik unter einer dauernden Spannung und Instabilität, jederzeit kann sie sich in verschiedene Richtungen entwickeln und bewegt sich an keiner Stelle linear. So streng formal der Text mit seiner antiken Dramaturgie gebaut ist, so variantenreich und unvorhersehbar ist die Komposition gestaltet. Saariaho hat sie als „music of care“ bezeichnet, eine existenzielle Untersuchung über Schuld und Unschuld, die immer nahe an ihren Figuren ist, sie nicht verurteilt und in eine bestimmte Richtung drängt. Trotz seiner grausigen und unendlich traurigen Thematik ist „Innocence“ ein menschenfreundliches, an vielen Stellen helles Werk, eine Suche danach, was uns auch im tiefsten Elend noch Trost geben kann. Das Trauma kann nur überwunden oder zumindest beherrschbar werden, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir sprechen, erzählen und zuhören. Deshalb endet die Oper mit einem offenen Akkord: Der „standstill“, von dem Tereza mehrmals spricht, ist auflösbar, der Weg zurück ins Leben ist möglich.
- Quelle:
- Innocence
- Staatstheater Nürnberg
- Oper von Kaija Saariaho, Saison 2025/26
- S. 23-30
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe